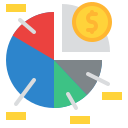Kyoto, 1. bis 10 Dezember 1997
Das richtungsweisende Kyoto-Protokoll wurde verabschiedet:
Das zentrale Ziel des Kyoto-Protokolls war, den Ausstoß der sechs wichtigsten Treibhausgase zu begrenzen. Im Zeitraum von 2008 bis 2012 sollte er im Durchschnitt um 5,2 Prozent im Vergleich zum Wert von 1990 gesenkt werden.
Die wichtigsten Beschlüsse, die auf der 3. COP getroffen wurden, umfassen Folgendes:
Verbindliche Emissionsreduktionsziele für Industrieländer: Das Kyoto-Protokoll legte verbindliche Emissionsreduktionsziele für Industrieländer fest, die als Annex B-Länder bezeichnet werden. Die Zielsetzung bestand darin, die Emissionen dieser Länder bis zum Zeitraum 2008-2012 im Vergleich zu den Emissionsniveaus von 1990 zu reduzieren. Die spezifischen Zielvorgaben variierten je nach Land.
Flexible Mechanismen: Das Kyoto-Protokoll führte drei flexible Mechanismen ein, um den Ländern bei der Erreichung ihrer Emissionsziele zu helfen. Diese Mechanismen waren der Emissionshandel, der Clean Development Mechanism (CDM) und der Joint Implementation (JI). Sie ermöglichten es den Annex B-Ländern, Emissionsreduktionen in anderen Ländern umzusetzen und diese als Gutschrift für ihre eigenen Ziele anzuerkennen.
Schaffung eines internationalen Emissionshandelssystems: Das Kyoto-Protokoll legte den Grundstein für den internationalen Handel mit Emissionsrechten, bei dem Länder, die ihre Emissionsziele übertreffen, Emissionsrechte verkaufen können, um von anderen Ländern gekauft zu werden, die ihre Ziele nicht erreichen.
Finanzielle Unterstützung für Entwicklungsländer: Das Kyoto-Protokoll verpflichtete die Industrieländer zur Bereitstellung finanzieller Ressourcen und Technologietransfer an Entwicklungsländer, um sie bei ihren Anpassungs- und Minderungsmaßnahmen zu unterstützen.
2001 lehnten die USA – die für einen großen Teil des CO2 Emissionen verantwortlich sind – die Ratifizierung des Abkommen ab.
Das Kyoto-Protokoll trat schließlich im Jahr 2005 in Kraft, nachdem es von ausreichend vielen Ländern ratifiziert wurde. Es gilt als wegweisendes Abkommen im globalen Klimaschutz und legte den Grundstein für weitere Verhandlungen und Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen.
Als 2011 auch Kanada aus dem Abkommen ausschied, hielten viele Beobachter das Kyoto-Protokoll für gescheitert. Doch die Emissionen der verbleibenden Industrieländer sanken bis 2012 tatsächlich deutlich, um 20 Prozent im Vergleich zu 1990. Damit wurden die ursprünglichen Ziele um das Fünffache übertroffen. Die Europäische Union allein hatte den CO2-Ausstoß bis 2012 um 19 Prozent reduziert, Deutschland um 23 Prozent.
Im selben Zeitraum waren allerdings die Treibhausgas-Emissionen weltweit um rund 38 Prozent angestiegen. Das Abkommen reicht nicht aus, um den Anstieg der Erderwärmung langfristig zu begrenzen, denn: “Der Vertrag beinhaltet Verpflichtungen für Länder, die insgesamt gerade mal für 24 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen standen. Das ist zu wenig, wenn man das Problem lösen will”, sagt Andrew Light vom World Resource Institute.
“Der Vertrag war auch ein ‘Gamechanger’ für die Erneuerbaren Energien”, sagt Karsten Neuhoff vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. “2007 sagte jeder noch, 20 Prozent Erneuerbare Energien in Europa 2020, das sei utopisch. Heute ist es Realität.” Neuhoff weiter: “Kyoto ist nicht allein für Investitionen in die Energiewende verantwortlich, aber es war ein wichtiger Impulsgeber.”
Die COP-Konferenzen haben in den letzten Jahren eine hohe Aufmerksamkeit erlangt, insbesondere aufgrund der Dringlichkeit des Klimawandels und der Notwendigkeit, internationale Zusammenarbeit und Maßnahmen zu fördern, um die Emissionen von Treibhausgasen zu reduzieren und die Auswirkungen des Klimawandels zu mildern.
- 100% Grün
- 100% Klimafreundlich
- 100% Unabhängig